Einmal hätte ich um ein Haar den amerikanischen Pianisten Keith Jarrett verklagt. Und das kam so:
Als ich in der Quarta und Untertertia hauste, stimmte mein Konzept von „Pflicht, Ordnung und Pünktlichkeit“ nicht immer mit dem meines Klassenlehrers überein, was dazu führte, dass dieser mir gleich staffelweise „Nachsitzen“ aufbrummte. Solche pädagogischen Maßnahmen – heutzutage zu Recht verpönt! – galten damals noch nicht als Verstöße gegen die Menschenrechtskonventionen und wurden zur Bekämpfung flacher Lernkurven gerne eingesetzt. Mich bestärkten sie indessen nur in der Annahme, dass schwere Dachschäden zum Berufsbild des Lehrers gehörten.
Wie oft ich den Preis für die Engstirnigkeit der Pädagogen zu zahlen hatte, weiß ich nicht mehr, aber ich saß wirklich oft und stundenlang meine Strafe in der Lehrerbibliothek ab. So kam es, dass ich meinen Nachhauseweg öfter Dienstag nachmittags durch das verlassene Schulgebäude antreten musste. Eines Tages gewahrte ich dabei sphärische Bruchstücke eines Klavierspiels, welche vom anderen Ende des langen Ganges herbeischwebten, dorther, wo ein Bösendorfer Mignonflügel in der Teppenhalle stand. Uns Schülern war es strengstens verboten, auf dem Instrument zu spielen, aber jetzt schien ein Profi am Werke, denn die Bruchstücke fügten sich bei näherem Hinhören zu einer anmutig ephemeren und wunderschön elegischen Melodie! Nicht zu entscheiden, ob ich einer stimmungsvollen Komposition oder einem genialen Extempore lauschte – mit jeden Schritt, den ich näher kam, entfaltete die Musik mehr Zauber und mehr Sehnwucht.
Als ich die Mitte des Ganges erreicht hatte, legte sich jedoch allmählich eine zweite Tonspur auf meine Ohren. Es war ein kakophones Geklimper, dass stetig lautstärker wurde, während die schöne Melodei immer mehr entschwand, als bedürfte das ohnehinnige Schicksal des Entschwindens noch eines Zaunpfahlwinks – wenn man versteht, was ich meine.
In der Teppenhalle angelangt, sah ich, was ich halb erwartet hatte und was mich halb überraschte: irgendwelche Antipoden bearbeiteten unkoordiniert den Flügel. Es tat den Ohren schrecklich weh.
Zunächst nahm ich all das einfach so hin. Gedankenlosigkeit ist der glücklichen Jugend Patentrezept. Erst als mir Ähnliches f.f. noch mehrmals widerfuhr, kam ich ins Grübeln.
Wo, fragte ich mich, kam eigentlich die Musik her? Vom Bösendorfer nicht, der wurde ja von meinen Antipoden malträtiert! Wenn man irgendwelche extradimensionalen Ursprünge ausschloss – und das tat ich -, blieb eigentlich nur noch mein eigenes Gehirn als Quelle des Wohlklangs übrig. Die Musik, sagte ich mir, muss in meinem Kopf entstanden sein. Dieser hatte also offensichtlich Ordnung in den Tonsalat gebracht, ungefragt und mühelos. Das Überraschende an dieser Erklärung war, dass ich mein Gehirn bis dato für ausgesprochen unmusikalisch gehalten hatte und diese Einschätzung wurde übrigens von Fachleuten geteilt. Im Musikunterricht war ich niemals über ein Befriedigend hinausgekommen, egal wie schön ich auch immer kurz vor den Notenkonferenzen unserer Lehrerin Frau Berentzen vorgesungen hatte.
Ein Jahr später (sic!) hörte ich techtelmechtelbegleitend zum ersten Mal den ersten Teil des ersten Teils des legendären Köln Concert des amerikanischen Pianisten Keith Jarrett und war schockiert: dieser Typ, dieser Jarrett, spielte da doch tatsächlich notengetreu meine Schulflur-Elegie! Verunziert von Stöhnern und Knacksern, aber ansonsten in Reinkopie! Was sollte das? Was, zum Geier?
Anfangs war ich erbost. Wie kam dieser Typ, dieser Jarrett-Pillermann, dazu, so unverfroren einem jungen und harmlosen Schüler geistiges Eigentum zu entwenden? Und wie hatte er das überhaupt angestellt? Diese Frage bedurfte der Klärung, bevor rechtliche Schritte unternommen werden konnten. Doch erwies sich die Beweislage auch nach langem Nachdenken als ungünstig für mich. Dieser Jarrett war ein gefeierter Star und ich nur ein Schüler mit ’ner Drei in Musik – an ein faires Gerichtsverfahren zu glauben, war angesichts dessen mehr als naiv!
Letztlich – ob man’s glaubt oder nicht – war es mein gutes Herz, dass mich zwang, Keith Jarrett juristisch zu verschonen. Dieser bedauernswerte Tropf war doch nur ein Jazzmusiker und Jazzmusiker haben doch nichts außer ihrer Musik, selbst wenn es nicht die eigene ist. Deshalb gucken sie ja auch immer so ernst und gewichtig. Wenn sie denn überhaupt gucken. Oft sitzen sie ja mit unmodischen Klamotten hinter ihren Instrumenten und kneifen die Augen feste zu. Nicht nur wegen des Publikums. Nein, die Musiker suchen eher Zuflucht im inneren Geklimper. Alternativ tragen manche Jazzer ein seelig-schizoides Dauer-Lächeln im Gesicht und reißen die Augen weit auf als hätten sie einen Lötkolben im Hintern. Nein, einen Jazzmusiker wollte ich nicht verklagen. Das hätte mein Gewissen letzlich nur belastet.

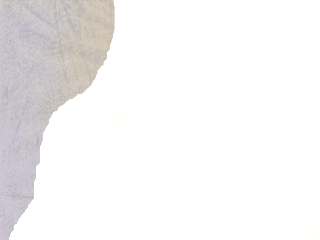
Neueste Kommentare